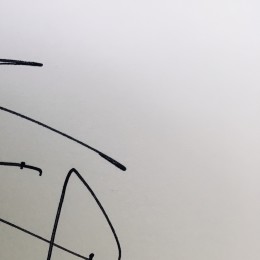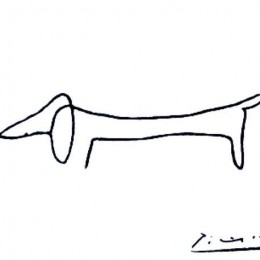Von Attacken und ausbleibenden Debatten
Eine Kritik über die Kritik der Literatur

1:0 für Ijoma Mangold gegen Maxim Biller, so das Endergebnis in der Debatte um die vermeintlich „unglaublich langweilige“ deutsche Gegenwartsliteratur. Laut der alle Jahre wieder aufflammenden Polemik Maxim Billers − zuletzt auf mehr als 100 Zeilen lesbar in der ZEIT (Nr. 9) – räume die deutschsprachige Gegenwartsliteratur den multilingualen Fremdstimmen von Migranten keinen Platz ein, sondern reihe diese vielmehr in den eintönigen Chor der urdeutschen Einfältigkeit ein, wo Nazi-Enkel im Verleger- und Lektorengewand allzeit den Taktstock schwingen, also den Ton angeben.
Wie erleichternd, dass Mangolds Stoizismus an Billers „Spielaufbau zuschanden“ geht, er mit „Fremdling, erlöse uns“ eine gelungene Erwiderung (ZEIT Nr. 10) schreibt, die sich uns alle vor ihm verbeugen lässt und darüber hinaus auch dem jüdischen Unruhestifter Biller beweist, dass es Leute mit nicht-deutschem Namen in unserem – diesem vom Weißen Band zusammengehaltenen – Land zu guten Kritikern und an die Spitze des deutschen Feuilletons bringen. Wie schade hingegen, dass jetzt schon wieder alles vorbei ist. Das Spiel scheint aus; die aktuelle ZEIT (Nr. 11) belässt es bei einer schönen Rezension zum zweiten Roman von Saša Stanišić, den auch der Demagoge Biller von seiner Kritik nicht verschont lässt. Dabei hätte sich Biller lieber ein Vorabexemplar dieses vielstimmigen neuen Textes schicken lassen sollen, bevor er behauptet, dass der Autor, der 1992 im Alter von 14 Jahren mit seinen Eltern aus Bosnien-Herzegowina nach Süddeutschland flüchtete, mit diesem Roman seine eigenen Wurzeln verlasse, das Setting Uckermarck mehr sein Neudeutschsein als sein Migrantendasein beweise − und überhaupt alles, was er dafür kassiere, ohnehin nur als „Wohlfühlpreis“ zu bezeichnen sei.
Die Diskussion zur deutschen Gegenwartsliteratur wurde also mit zwei nur Artikeln ausgefochten. Mit Verweis auf den Spielcharakter, den Mangold selbst in seiner Erwiderung benennt, Biller sogar ob seiner Fähigkeit, direkt auf das vegetative Nervensystem einzuwirken, einen Punkt verleiht, möchte ich mit dem deutschen Fußballspieler Sepp Herberger argumentieren: nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Es ist pädagogisch zwar äußerst wertvoll, sich nicht durch Wut zu Wut animieren zu lassen, aber es zeugt nicht gerade von Mut, nur auf dieser sehr strukturell argumentierenden Oberfläche zu verhaften. Der Blick, mit dem Mangold die „Grobschlächtigkeit, mit der [Biller] sich seine Argumente und Reizvokabeln zurichtet“, enttarnt, sollte kein Ende der Debatte bewirken. Bei allem „Selbstaufruf zur Affektkontrolle“ darf doch nicht das diskussionswütige Herz eines Literaturkritikers aussetzen. Vielmehr muss doch eins und eins zusammengezählt werden: Aha. Erst also drucken wir Florian Kesslers Auffassung, die „brav[e]“ und „konformistische“ Gegenwartsliteratur sei auf das saturierte Milieu zurückzuführen, aus dem die Absolventen der Schreibschulen Leipzig und Hildesheim kommen (vgl. ZEIT Nr. 4), und nur fünf Wochen später überlassen wir Biller die Titelseite des Feuilletons, um über die angebliche Vorherrschaft des Urdeutschen im Literaturbetrieb zu philosophieren, die in nationalsozialistischer Manier jedes aufrührerische Potenzial migrationsliterarischer Stimmen ausmerze. Kann man mir folgen? Wenn Kessler aufzeigt, dass „[i]n jeder Saison der letzten Jahre […] mehr als die Hälfte aller bis in die Feuilletons vordringenden Romandebütanten an einem der beiden Institute ausgebildet“ wurde, sollte das auch im Zusammenhang mit Billers Vorwurf gelesen werden, in dem dieser Autoren und ihre Texte benennt, die an jenen Instituten entstanden sind. Saša Stanišić und Olga Grjasnowa schmiedeten ihre literarischen Debüts ebenfalls an diesen Instituten – zusammen mit Clemens Meyer, Juli Zeh, den „Professorenkindern Nora Bossong, Paul Brodowsky“ und dem „Managersohn“ Leif Randt. Die Schreibausbildung der deutschen AutorInnen findet demzufolge zum Teil unter demselben Dach statt wie die der in deutscher Sprache schreibenden Migranten(-kinder). Mit Rekurs auf diesen Umstand scheint die billersche Forderung doch geradezu absurd, dass Migranten immer über ihre Herkunft und den culture clash schreiben sollten, den diese in Auseinandersetzung mit Deutschland bewirke. Genauso gut hätte auch eine Nora Bossong von Grammofon reparierenden Soldaten schreiben können. Saša Stanišić hat ihr eine solche Geschichte vielleicht bei einem guten Glas Wein auf einer der wöchentlichen Pyjama-Partys des Instituts hinter vorgehaltener Hand erzählt. Trends und Tendenzen des Schreibens und Denkens sind immer schon an Schulen, Gruppen und Orte gebunden gewesen – man denke an die Frankfurter Schule oder die Gruppe 47. Vielleicht ließe sich – in Anknüpfung an Kessler – besser das Gemeinsame im Schaffen der in Leipzig und Hildesheim ausgebildeten AutorInnen untersuchen als die nationale Identität im Text eines Autors, die dann mit der des Autors übereinstimmen müsste. Im Einwanderungsland Deutschland darf man seinen literarischen Stoff frei wählen. Auch ich als Deutsche kann einen Text schreiben, der von Vertreibung, Flucht, Exil und vielem mehr berichtet, zumal Autor und Erzähler nicht ein und dasselbe sind − auch wenn Biller für eine Gleichsetzung dieser literaturwissenschaftichen termini tecnici plädieren würde.
Wenn es Biller aufregt, dass den schriftstellerischen Migranten nicht gewährt wird, zu einer bedeutsamen Strömung im literarischen Einfaltsland zu werden, muss man sich doch fragen, woher dieser Wunsch nach Markierung von Differenz herrührt. Es gibt zumindest in der Literaturwissenschaft einen Bereich, der jene Literatur umfasst und analysiert, die von Eigen- und Fremderfahrung der eigenen Kultur sowie fremder Kultur(en) berichtet: es ist die sogenannte Interkulturelle Literatur(-wissenschaft). Zu dieser Literatur – und das wird dem Deutschlandhasser Biller sicherlich missfallen – zählt eine Felicitas Hoppe ebenso wie ein Saša Stanišić, wird Yoko Tawada mit Hoffmanns Der Sandmann zusammengebracht − und überhaupt über vieles nachgedacht. Auch gemeinsam gelacht. Ja, man stelle sich vor, dass deutsche und nicht-deutsche Schriftsteller auch etwas miteinander tun, etwas gemeinsam haben – sie sind zum Beispiel erlebende Wesen.
Dass Menschen verschiedener Kulturen etwas Gemeinsam haben, stellt Saša Stanišić mit seinem neuen Roman Vor dem Fest eindrücklich unter Beweis. Ja, es ist nötig, diesen Autor und Text – obwohl er ja schon so viele „Wohlfühlpreise“ bekommen hat oder noch bekommen wird − hier nochmals zu würdigen: was die magisch aufgeladene Wir-Erzählstimme in einer Anatomie des fiktiven Dorfes Fürstenfelde von diesem berichtet und/oder verschweigt, sind Geschichten von Flucht und Vertreibung und vom Alteingesessenen gleichermaßen. Entfaltet wird der Witz hier jedoch nicht über den Alteritätsdiskurs der Anderen, sondern im „Haus der Heimat“ selbst, wo in der dunklen Jahreszeit eine depressive Mutter ihre 130 kg nur zum Auftischen von Rote Beete gebraucht und die Tätowierung eines rumänischen Spargelstechers zur Vorlage des Lieblingsbildes der Dorfmalerin Frau Kranz wird, die manchmal auch Neonazis beim Schlafen malt. Im literarischen Heimatmuseum stehen Geschichten von Krieg und Vertreibung neben und in der Alltagswelt, wo noch immer jährlich das Annenfest zelebriert wird, das schon seit dem 16. Jahrhundert Bestandteil der Dorfkultur ist − und ganz vielleicht auch mit dem Titel des Romans zusammengedacht werden kann. In dem Dorf, das ob eines Saufgelages seinen Stadt-Status vor geraumer Zeit verloren hat, leben Füchse, Azubis und halbe Nazis friedlich zusammen. Aber jetzt ist der Fährmann tot. Und nu?
Jetzt erkennen wir alle, dass hier wie auch in Stanišić‘ Romandebüt der Tod einer wichtigen Bezugsperson von Bedeutung für die Handlung ist − damals war es der Opa für den jungen Ich-Erzähler, jetzt ist es der Fährmann für das Wir des Dorfkollektivs. In beiden Fällen führt der Tod die Reflektion über die Heimat ein.
Stanišić hat während seiner Recherchen im realen Fürstenwerder das Gemeinsame der Mythen dieses Dorfes mit denen seiner Heimatstadt entdeckt. Dieser ,Aha-Effekt‘ generiert sich gerade aus der fremden Perspektive des mit Biller gesprochenen Neudeutschen Stanišić, aus seinem Interesse an deutschen Mythen, die bei uns in der hintersten Schublade verstauben. Mir erscheint der Verweis auf das Entdecken von Gemeinsamkeiten der Kulturen, die der Autor in seiner Lesung im Hamburger Literaturhaus als besonders inspirierend herausgestellt hat, als weitaus sinnvoller als die Herstellung der von Biller propagierten Texte voll von Rekursen auf die eigene Biografie. Denn mit dem von Stanišić vorgelegten textuellen Verfahren, das alte Geschichten und ihre geteilten geografischen Spuren auf witzige Weise in eine neue Geschichte zu fassen und vereinen vermag, entpolitisiert man keine Migrationsdebatte, sondern führt vielmehr deren interkulturelle Dimension aus. Darüber sollten wir in Diskussion kommen und nicht über die Abgrenzungsverfahren, die Biller seit 30 Jahren propagiert. Die Türen zu anderen Schreiborten stehen Ihnen offen, Herr Biller! Und der ZEIT steht es offen, die Diskussion über Inhalte und nicht über Argumentationsstrukturen fortzuführen. So gibt es anlässlich des Artikels von Florian Kessler am Literaturinstitut Leipzig am 14. März eine Diskussion über das Brave in der deutschen Gegenwartsliteratur. Nicht nur in Leipzig ist eine solche Diskussion möglich. Auch hier. Wir sind ja hier. Die ZEIT sitzt in Hamburg. Und auch Studierende der Universität Hamburg sitzen hier, voller Lust auf kontroverse Diskussionen. Dafür müssen keine Doppelseiten im Feuilleton-Teil zur Verfügung gestellt werden – führen wir diese lebendige Debatte doch live! Mit einer guten Portion Fragen wie auch Expertise auf dem Tisch! Denn im Master-Studium Deutschsprachige Literaturen kann man sich in genau dem Bereich profilieren, über den die ZEIT auch immer wieder schreibt: über Literatur, deren Figuren und Autoren sich in einem weit gefächerten Netz verschiedenster Kulturen bewegen.
Es befruchtet, die von Kessler und Biller ausgeführten Attacken auf die deutsche Gegenwartsliteratur als Ausgangspunkt für richtige Debatten zu nutzen, diese an Orte zu tragen − und nicht nur rhetorisch von Salon-Löwe zu Salon-Löwe zu fragen, ob „es die wilde Kunst nur bei Migranten“ gibt. Lust?