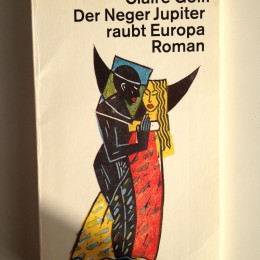Heimat im Offenen?
Konstruktionen von Heimat im Wechselspiel zwischen Begrenzung und Entgrenzung in ausgewählten Gedichten Friedrich Hölderlins von 1800 bis 1803
1 Einleitung
‚Heimat‘ ist ein Schlüsselwort des poetischen Weltverständnisses von Friedrich Hölderlin. Unzählige Gedichte bezeugen die motivische Verhandlung von Heimat des von 1770 bis 1843 lebendenden deutschen Autors schon ihrem Titel nach: „Heimat“, „Die Heimat“, „Heimkunft“ oder auch „Rückkehr in die Heimat“. Hölderlin, dessen Werk posthum eine eigenständige Stellung innerhalb der deutschsprachigen Literatur um 1800 zwischen Weimarer Klassik und Romantik zugesprochen wurde, entfaltet ‚Heimat‘ in seiner Lyrik als ein soziales, lebensgeschichtliches, poetisches und poetologisches Grundwort. Seine intensive − fast schon ubiquitär verbreitete – Auseinandersetzung mit diesem Thema generiert in seiner Lyrik Konstruktionen von Heimat, die zwischen geografischen und imaginativ mythisch-religiösen Räumen schwanken. So schließen auch Heimatverpflichtung und Weltbürgerlichkeit in Hölderlins Lyrik einander nicht aus, sondern bedingen einander meiner Meinung nach vielmehr. Bereits 1988 hat Walter Jens mit seinem Essay „Nachdenken über Heimat. Fremde und Zuhause im Spiegel deutscher Poesie“ den Blick für dieses Bedingungsverhältnisaus geöffnet. In seiner literarischen Erkundung des Heimat-Motivs in deutschsprachiger Prosa stellt er jedoch auch die These auf, dass Hölderlins Heimatverpflichtung dem Umstand geschuldet sei, dass dieser den Bruch der Treue zur Heimat für einen Verrat des Poetenamts gehalten hätte.[1] Obgleich es unumstritten ist, dass dem Heimat-Motiv ein programmatischer Stellenwert im literarischen Œuvre Hölderlins zukommt und es im Anschluss an sein Dichtertum diskutiert wurde, scheint Jens ‚Heimat‘ hier nur als geografisch fixierbare Koordinate im Leben Hölderlins und vor allem als Synonym für das Vaterland oder die Heimatstadt Hölderlins zu verstehen. Diese Ansicht greift aber zu kurz, denn wenngleich ‚Heimat‘ bei Hölderlin häufig als ‚Vaterland‘ oder als bedeutsamer spezifischer Ort in Hölderlins Leben (z. B. Nürtingen, Denkendorf, Maulbronn oder auch Tübingen) apostrophiert wird, erscheint ‚Heimat‘ in den Gedichten doch auch jenseits solch feststehender geografischer Koordinaten. ‚Heimat‘ wird bei Hölderlin in Bezug zu „geschichtlichen, religiös-mythischen und kulturräumlichen Spannungen“[2] gesetzt und verhandelt. Das Schlüsselwort ‚Heimat‘ ist demnach im Kontext von Hölderlins Werk eines, das zwar auf den ersten Blick sehr verfügbar zu sein scheint, aber „in Wahrheit, um in der Vielfalt der Erscheinungsformen begreifbar zu werden, Gedankenanstrengung bedarf“[3]. ‚Heimat‘: „[e]in nüchternes und ein poetisches, aber ein rätselhaftes Wort. Ein Wort, über das in den Spuren der Dichter nachzudenken bedeutet: sich des scheinbar Selbstverständlichen kundig zu machen, das, recht betrachtet, das Befremdlichste ist […].“[4] Das (vermeintlich) Eigene als das Fremde zu verstehen ist für die Rezeption Hölderlins also von nicht zu vernachlässigender Bedeutung, wie auch das folgende Zitat des Autors selbst aus einem Brief an Böhlendorff im Dezember 1801 zeigt: „Aber das Eigne muß so gut gelernet seyn wie das Fremde.“[5] Die zeitgleiche Verhandlung der vermeintlich binären Kategorien von Eigenem und Fremdem erweist sich als äußerst produktive, denn sie spricht die „poetisch-ästhetische Imagination an[]“[6] und versetzt diese in Bewegung.[7] Es kann als ein Wagnis verstanden werden, dass Hölderlin ‚Heimat‘ in Spannung zu Geschichte, Mythos, Religion und Kultur verhandelt. Er beschränkt ‚Heimat‘ nicht auf lyrische Reisen in die Kindheit und die Orte ebendieser. So formuliert Wolfgang Braungart, dass „[a]us der ‚Arbeit‘ der Einbildungskraft […] der eigentliche Raum des Poetischen [dann entsteht …], wenn sie sich dabei nicht genug ist, wenn sie sich öffnet und herausfordern lässt“[8]. Hiernach lässt sich auch Braungarts ausdrückliche Anerkennung Hölderlins verstehen, wenn er formuliert: „Kein Dichter um 1800 wagt in seiner Lyrik so viel wie Hölderlin“[9].
Diese Hausarbeit setzt sich mit dem Heimat-Motiv in seiner sprachlich-ästhetischen Darstellung bei Hölderlin anhand der Interpretation von drei Gedichten aus den Jahren 1800 bis 1803 auseinander. Es wird versucht, nachzuzeichnen und zu erläutern, inwiefern sich das dort abgebildete Heimatverständnis als anschlussfähig an ein gegenwärtiges, offeneres, umfassenderes, nicht nur geografisch beschränktes Verständnis von Heimat erweist und gegebenenfalls gerade deshalb erneut und vermehrt von der Forschung betrachtet werden sollte.
Um 1800, also in der Phase der anbrechenden Moderne, die selbst bereits ein Bewusstsein ihrer Modernität hat und daraus ihr Epochen-Bewusstsein zieht, ist kein Dichter mit seinem Leben und seinem Werk so sehr auf seine Heimat bezogen, auf sein Herkommen, seine topographische, sprachliche, menschlich-soziale Zugehörigkeit und seine von dorther rührenden konkreten, ‚aisthetischen‘ Erfahrungen […] wie Friedrich Hölderlin.[10]
Wenngleich Hölderlin, wie es Braungart hier herausstellt, bemerkenswert intensiv „bezogen“ war auf die Thematisierung von ‚Heimat‘, beließ er sie meines Erachtens nach nicht im Geografischen und Selbstbiografischen, sondern
erlöste sie aus diesem Zusammenhang, in dem er sie einem universal gedachten Beziehungsmodell zwischen Menschen zuordnete. […] In diesem Modell verlor die Heimat als Geburtsland, als Landschaft der Kindheit an Gewicht, ohne ganz verabschiedet zu werden.[11]
Eine scheinbare Paradoxie zwischen Auf- und Abwertung der geografischen Heimat zeichnet auch das gegenwärtige Verständnis von ‚Heimat‘ in unserem westlichen Kulturraum aus: ‚Heimat‘ gewinnt „im Zeitalter der Internationalisierung und Globalisierung durchaus an Bedeutung“[12], wenngleich die konkrete biografische Heimat dabei als Grundkoordinate des Selbst weniger bedeutsam ist als die selbstgewählten Koordinaten von Studienort und Freundeskreis. So formuliert auch Ina-Maria Greverus in ihrer Habilitationsschrift Der territoriale Mensch. Ein literaturanthropologischer Versuch zum Heimatphänomen, dass
Heimat […] sich auch in unserer Gegenwart, dem Zeitalter einer extensiven Mobilität der Menschen und einer direkten und indirekten mondialen Kommunikation, noch immer als ein Problem menschlicher Suche nach umgrenzten und selbsterfahrenen Identitätsräumen [herausstellt].[13]
Gerade im Zuge zunehmender Globalisierung und deren kosmopolitischen Herausforderungen für den Menschen scheinen Reflexionen über ‚Heimat‘ zuzunehmen. Wo geografisch verortete Heimaten aufgrund von Migrations- und Exilbewegungen für viele Menschen kaum noch zugänglich sind und ein geografisch fundiertes Heimatkonzept folglich für das Offene entgrenzt wird, zeigen andere Tendenzen eine Aufwertung des Privaten als kleinsten denkbaren Raum für Heimat.
Die für die Analyse herangezogenen drei Gedichte entstammen zwar alle den ersten drei Jahren des 19. Jahrhunderts, damit ist jedoch nicht beabsichtigt, das Heimat-Motiv als Zeitstilphänomen einzufahren oder als konkrete bedeutsame Phase in Hölderlins Schaffen herauszustellen. Vielmehr ist diese meine Gedichtauswahl als eine Art Stichprobe zu verstehen, die abseits der gängigen Verhandlung von ‚Heimat‘ in Hölderlins Werk operiert, explizit in Abgrenzung gedacht ist zum Beispiel zu Jochen Schmidts etablierten Oberbegriff „Heimatelegien“ für die Gedichte „Der Wanderer, „Stutgard“, „Heimkunft“ und „Der Gang aufs Land“[14]. Der eigens gewählte Textkorpus kann und soll folglich ‚nur‘ als subjektiv motivierte Stichprobe verstanden werden. Eine Katalogisierung und Entwicklung von Oberbegriffen für die die Heimat thematisierenden Gedichte führt meines Erachtens nach zu einer starken Einschränkung des Blicks auf dieses Motiv. Den unzähligen Heimatgedichten Hölderlins würde man damit nicht gerecht. Wenngleich auch mit dieser Arbeit das Motiv hinsichtlich seiner Bedeutsamkeit für das Gesamtwerk Hölderlins nur auszugsweise behandelt wird, so kann die Rezeption des Heimat-Motivs zumindest mit zwei der drei hier behandelten Gedichte erweitert werden, die ihrem Titel nach nicht primär auf das Heimat-Motiv verweisen oder ein solches assoziieren lassen und die zudem in diesem Kontext auch noch nicht verhandelt wurden. Die Heimatdichtung Hölderlins um 1800 wird hier folglich eher als eine Art Ideendichtung zu einer Zeit verstanden, die zu einer der besonders produktiven Hölderlins gezählt wird. Das Heimat-Motiv ist, wie es die einleitenden Worte dieser Arbeit vermuten lassen, ein viel rezipiertes. Die Deutung dieses Motivs erfolgte in der Forschung jedoch meist vor dem Hintergrund des Heimatverständnisses im Diskurs ihrer Produktionszeit oder wurde im Anschluss an das Heimatverständnis der Rezipienten selbst besprochen. Letztere Auseinandersetzungen mit dem Motiv liegen schon einige Jahre zurück, und so erscheint es mir dringend nötig, Hölderlins Werk bezüglich dieses Motivs zu aktualisieren. Dabei wird nicht das eigene subjektive Heimatverständnis den Hölderlinschen Gedichten aufgepfropft. Die Gedichte regen mit ihrer Verhandlung des Themas Heimat vielmehr dazu an, das eigene Verständnis zu überdenken. Auch Rüdiger Görner betont in seinem Aufsatz „Im Widerspruch zu Hause. Zu Hölderlins Heimat-Bild“ 1992 die Gefahr, „dass „man sich [gemeinhin glaubt] auszukennen mit Hölderlins anscheinend rückhaltloser Bejahung des Heimatlichen“[15] und dazu neige, das Heimat-Motiv einseitig zu beleuchten. So hat laut Görner – und dem möchte ich mich anschließen − „[n]eben Wolfgang Binder […] bislang nur Walter Jens ein Fragezeichen hinter diese Einschätzung gesetzt, indem er nämlich auf die Konjunktive hinwies, die einige der lyrischen Heimatbeschwörungen Hölderlins prägen“[16]. Neben der hier anerkannten Deutung des Heimat-Motivs seitens Jens stellte bereits Binder 1954 in „Sinn und Gestalt der Heimat in Hölderlins Dichtung“ heraus, „daß die Heimat zu den zwei oder drei unbestreitbaren Wirklichkeiten gehört, auf denen Hölderlins Weltbild und Lebensgefühl ruhen“[17]. Eben mit dieser Wirklichkeit wird sich in dieser Arbeit intensiv auseinandergesetzt. Im Anschluss an eine Verständigung über Heimat (vgl. Kapitel 2) wird die Analyse der drei ausgewählten Gedichte „Die Heimat“ (1800), „Die Wanderung“ (1801) und „Mnemosyne“ (1803) folgen. Die Gedichte, die ob des Umfangs dieser Arbeit nicht ihrer jeweiligen Interpretation vorangestellt werden können, finden sich im Appendix. Es wird die von Jochen Schmidt herausgegebene DKV-Ausgabe aus dem Jahr 2005 genutzt. Die Gedichte generieren, wie die Analyse zu zeigen versucht, verschiedenste Assoziationen zum Thema Heimat, die nicht in den binären Kategorien von Bleiben und Wandern, von Fremde und Eigenem zu verorten sind, sondern diese Kategorien zugunsten eines dynamischen Heimatverständnisses aufbrechen, das somit auch im Zeichen des Harmonischentgegengesetzten zu verstehen ist. Das Harmonischentgegengesetzte offenbart sich in den Gedichten folglich als ein „poetisch äußerst fruchtbare[] Schwebezustand“[18]. In der Vokabel ‚Heimat‘ sind sowohl Strategien von Verortung als auch Entgrenzungsentwürfe gleichermaßen zu finden – Räume werden mit ihren Grenzen zueinander beschrieben, diese aber dennoch durchquert bzw. unterwandert. Die Schlussbetrachtung (vgl. Kap. 4) betont, dass Hölderlins Heimat-Dichtung im Widerspruch zuhause ist, ‚Heimat‘ bei ihm zwar nicht ausschließlich im Offenen verortet werden kann, eine Verortung im „Dazwischen“ aber möglich ist.
2 Statt einer Definition: Verständigung über Heimat
„Auf einen Begriff gebracht scheint ›Heimat‹ nicht zu haben zu sein. Davon zeugen nicht zuletzt die unzählbaren, miteinander konkurrierenden Versuche, ihrer definitorisch habhaft zu werden […].“[19] ‚Heimat‘ schließt eine große Bedeutungsvielfalt ein, weshalb es meines Erachtens nach folgerichtig ist, ‚Heimat‘ im Anschluss an Gunther Gebhard, Oliver Geisler und Steffen Schröter „als Assoziationsgenerator“[20] zu verstehen − gerade weil der Begriff ‚Heimat‘ eben auch bei jedem Individuum ganz subjektive Assoziationen entfaltet, von denen sich zugunsten einer allgemein gültigen Definition wohl nur schwer zu lösen wäre. In dem literaturwissenschaftlichen Sammelband Heimat im Wort. Die Problematik eines Begriffes im 19. und 20. Jahrhundert stellt Görner diesbezüglich fest: „Wer sich über Heimat äußert, ist vorbelastet; denn er spricht von einer unmittelbar persönlichen Erfahrung. Zudem geht er mit einem Begriff um, der bis zur Unkenntlichkeit ideologisiert, verkitscht und stilisiert worden ist.“[21] Viele Herleitungen des Begriffs stellen ein Näheverhältnis von Raum und Mensch heraus, betonen, dass die Vokabeln Raum und Zeit sich als eben jene aufdrängen, die Heimatempfindungen durch die Geschichte hindurch begleiten.[22] Die Bedeutsamkeit der genannten Vokabeln würde hinsichtlich ihrer Bedeutung dabei je nach Epoche variieren. ‚Heimat‘ erscheint folglich als ein „chamäleonhaftes Gebilde“[23], dessen unzählige und individuelle Assoziationen insbesondere über Vergleiche zu beschreiben versucht werden: „‚Heimat als…‘ oder: ‚Heimat ist, wenn…‘. Sie bedarf stets einer zusätzlichen Qualifizierung oder sentenzhaften Charakterisierung.“[24] Trotz des treffenden Verständnisses von ‚Heimat‘ als Assoziationsgenerator ist sie auch ein Gegenstand leidenschaftlicher Distanzierung, wird das Sprechen von ihr – gerade verstanden als eine biografisch-geografisch verbürgte Koordinate − im Prozess der Selbstfindung und einer damit häufig verbundenen Entfernung vom früheren, vom peinlichen Ich vermieden.[25] Zudem lässt selbst ‚Heimweh‘ „als moderner Reflexionsmodus von Heimat“[26] mittlerweile negative Konnotationen mitschwingen, denn eine solche gilt es doch zugunsten eines globalen Lebens als Kosmopolit zu überwinden. Die Verschiebung des Begriffes über die Jahrhunderte − aus einem rechtlichen Zusammenhang, wo der Begriff für einen beliebigen Ort stand, an dem man mit Recht leben durfte, hin zu einem historisch-politisch geprägten Begriff – ist in der Zeit der Verfechtung des Nationalstaates im 18. Jahrhunderts begründet und ist dann später vor allem auch im Kontext der zunehmenden Industrialisierung im 19. Jahrhundert als Reaktion und Opposition zu dieser zu verstehen. So ist der Auftakt der Reflexionen und Konzeptualisierungen von ‚Heimat‘ auf die Schaffenszeit Hölderlins zu datieren, der sich entsprechend auch in seinen Gedichten einschreibt.[27] Wenn Hölderlin in einem Brief an seine Mutter vom 22. Mai 1795 schreibt: „Man lernt sehr, sehr viel in der Fremde… Man lernt seine Heimath zu achten“[28], zeigt sich auch eine Faszination gegenüber dem Fremden, „die als Provokation des Eigenen die Identitätsverhandlungen des beginnenden 19. Jahrhunderts“[29] geprägt hat. So trägt „die literarische Topographie Hölderlins […] auch der zeittypischen Faszination des Unheimlich-Fremden Rechnung“[30].
Das Motiv des Wanderns, das im Konnex mit dem der Heimat gedacht werden muss, fungiert bei Hölderlin als Aufhebung einer ortsgebundenen Heimatvorstellung. Eine Beheimatung verspechende Einheit von Raum und dem in diesem lebenden Subjekt wird zunehmend aufgekündigt, denn Heimat stellt für Hölderlin auch Enge dar. „Es zeigt sich eine Bewegung, die zwischen Anziehung und Abstoßung oszilliert, und die als Grundmotiv heimatlicher Ambivalenz identifiziert werden kann.“[31] So werden konkrete Orte als Heimat bei Hölderlin verabschiedet, was mit den gegenwärtigen Tendenzen eines globalen Verständnisses von Heimat parallelisiert werden kann. Die Vorstellung von Heimat als Nicht-Ort wird vor allem in Bernhard Schlinks Essayband Heimat als Utopie aus dem Jahr 2000 verhandelt. Dort heißt es:
So sehr Heimat auf Orte bezogen ist, Geburts- und Kindheitsorte, Orte des Glücks, Orte, an denen man lebt, wohnt, arbeitet, Familie und Freunde hat – letztlich hat sie weder einen Ort, noch ist sie einer. Heimat ist Nichtort […]. Heimat ist Utopie.[32]
Das Utopische von Schlinks Heimat-Begriff ist eng mit einem Sehnen verknüpft, einer Sehnsucht nach dem, was gewesen ist und werden könnte. Heimat ist hier kein physischer Ort, sondern ein Gefühl, ein erinnerter oder imaginierter Raum, der vielmehr mit dem Erlebten oder Imaginierten als mit einem tatsächlichen Ort verbunden zu sein scheint. Vor allem der Aspekt der Heimat als Erinnerung und als Imagination ist besonders aus literaturwissenschaftlicher Perspektive interessant, weil dieser bei Hölderlin auch im Anschluss an Salman Rushdies „Imaginary Homelands“ gedeutet werden könnte. Die vorliegenden drei Gedichte gilt es im Folgenden auf ebensolche Aspekte hin zu prüfen. Meiner Meinung nach stellt Hölderlin mit seinen Gedichten selbst heraus, dass es die Heimat, wie seine Erzähler sie in ihrer Kindheit erlebt haben, nur noch als Imagination und Erinnerung gibt. „Ein Verständnis der utopischen als der eigentlichen Qualität von Heimat nimmt Heimat nichts“, so die Ausführungen Schlinks.
Es erlaubt [vielmehr] die individuelle Mischung von Nähe und Distanz zum Ort, Erinnerung und Sehnsucht, Realität und Phantasie, die dem notwendig individuellen Begriff der Heimat entspricht.[33]
‚Heimat‘ ist ein Begriff, zu dem jeder ein Verhältnis hat, sie ist Teil unserer soziokulturellen Zugehörigkeit. Gerade deshalb ist der Begriff trotz einer fehlenden Definition präsent in Literatur und Philosophie und ist dort über die Epochen hinweg verhandelt und in seiner Bedeutung und Konnotation vielfältigen Verschiebungen unterworfen worden. Gerade eine philosophische Betrachtung von ‚Heimat‘ ist hier erwähnenswert, da auch diese sich als von Hölderlin-Lektüren angeregt erweist. 1960 schrieb der Philosoph Martin Heidegger – auf Hölderlin bezugnehmend − einen poetologischen Aufsatz zu „Sprache und Heimat“, der mit „Heimat und Sprache“ dann wiederum 1992 von Heideggers Schüler Hans-Georg Gadamer aufgegriffen wurde. Dass Hölderlins Heimatgedichte auch als Literatur gelesen werden können, die sich als Versuch versteht, sich mittels ästhetischer Konstruktionen von Heimat gegen die Entfremdung der Welt zu wehren, hat besonders Görner in seinen Geleitworten zu Heimat im Wort herausgestellt.[34] Gedichte, die Heimat konstruieren, sind demnach selbst als eine Art Heimat zu lesen. Auch Andrea Bastian rekurriert in Der Heimat-Begriff. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung in verschiedenen Funktionsbereichen der deutschen Sprache auf die Verbindung des Begriffes zur Philosophie. In ihrer Literaturanalyse meint Bastian zu erkennen, dass die dichterischen Entwürfe seit dem 18. Jahrhundert nicht nur von den subjektiven Heimatbildern der Dichter geprägt worden seien, sondern immer stärker auch mit „elementaren menschlichen Bedürfnisse[n] verknüpft“[35] und diese zum Ausgangspunkt philosophischer Fragestellungen genommen würden. Es erscheint angemessen, dass auf dem Einband von Karen Joistens Dissertationsschrift, Philosophie der Heimat – Heimat der Philosophie, ‚Heimat‘ als „eines der meistdiskutierten und am heftigsten umstrittenen Probleme unserer Zeit“ beschrieben wird. Joisten fragt sich, ob es zwischen der Wichtigkeit der Betonung von Heimat und den Haltungen eines globalisierten Zeitalters nicht zu Widersprüchen kommen müsse.[36] Dass die Wahrnehmung von Widersprüchen jedoch zu kurz gedacht ist, lässt sich gerade im Rekurs auf Hölderlin festmachen, denn: Heimatvorstellungen, die das Offene mitdenken, befinden sich nicht im Widerspruch, sondern präsentieren ein Denken über Heimat auf einer Metaebene. Ebendiese Metaebene wird in Hölderlins Lyrik eindrucksvoll auf inhaltlicher Ebene aufgeführt.
3 Heimat – im Eigenen und im Fremden: Drei Gedichte
Pietismus und Empfindsamkeit sind die herrschenden Mächte in dem Umkreis, in dem Hölderlin aufwuchs und zu schreiben begann. So sehr er ihnen über seine Jugendjahre hinaus verpflichtet ist, in seiner Behandlung des Heimatmotivs geht er eigene Wege.[37]
Binder stellt bezüglich der herausragenden Behandlung des Heimat-Motivs bei Hölderlin heraus, dass dessen geistige Begegnung mit ‚Heimat‘ sich im Wesentlichen auf drei Ebenen vollzieht: „in der Landschaft, in der Geschichte und in etwas, das man Geist der Heimat nennen könnte“[38]. Von diesen drei Ebenen konzentriert sich Binder in seiner Analyse dann jedoch ausschließlich auf die der Landschaft als dem Bereich „der konkreten Heimatanschauung und der Schwabenbegeisterung“[39]. Gerade weil eine solche Schwabenbegeisterung aber nach Binder um 1790 für Hölderlins Lyrik an Bedeutung verliert, das Heimat-Motiv aber fortwährend zentraler Bestandteil der Gedichte bleibt, halte ich die Auseinandersetzung mit den zwei anderen Ebenen für besonders vielversprechend. Im Folgenden muss daher eine Gegenposition zu Binder eingenommen werden, da dieser ‚Heimat‘ nicht als ein poetisches Motiv, „d.h. [als ein] poetisches Versatzstück“ in der Lyrik Hölderlins versteht, „sondern [… lediglich als] eine lebendige Erfahrung […]“[40]. Mit diesem starken Fokus auf die Biografie Hölderlins geht bei Binder die Analyse der Hölderlinschen Heimat-Konzeptionen als geschlossener Raum einher. Demzufolge ist ‚Heimat‘ „der Urraum Hölderlins. Aber nicht […] unendlich und nach allen Seiten offen, sondern geschlossen, ein Innenraum, ein Haus, eben eine Heimat“[41]. Bei Hölderlin hätten laut Binder alle Bilder der Heimat „diesen Raumcharakter, den Hölderlin dadurch veranschaulicht, daß er seine Teile nacheinander und in einer gewissen Ordnung nennt, entweder von oben nach unten oder […] von außen nach innen […]“[42]. Wenngleich ich Binder zustimme, dass Hölderlin Räume in einer gewissen Ordnung nennt bzw. vielmehr konzeptualisiert, erscheinen mir ebendiese Räume jedoch als miteinander verbunden, in Bezug zueinander gesetzt und damit in ihrer Begrenzung zueinander aufgebrochen. So richtet sich der Blick des lyrischen Ich in einigen Gedichten von der Erde auf den Himmel, Figuren wandern durch Länder oder kommen – wie der Schiffer in „Die Heimat“ − sogar vom Wasser ans Land. Das Durchwandern von vermeintlich begrenzten Räumen sei hier folglich sogar zwischen verschiedenen Elementen möglich. Die Bedeutung der Bewegung zwischen verschiedenen Orten und Räumen zeigt sich in allen drei hier verhandelten Gedichten: in „Die Heimat“ wird das Durchwandern von Orten eben besonders durch die transitorische Figur des Schiffers deutlich, in „Die Wanderung“ will das lyrische Ich frei sein wie eine Schwalbe in der Luft, und in „Mnemosyne“ wird eine Bewegung von den Alpen in das antike Reich der Heroen über den Kaukasus beschrieben. Die folgende Auseinandersetzung mit ebendiesen drei Gedichten wird die von Binder ausgesparten Ebenen näher untersuchen, weil sich auf diesen besonders eindrücklich das Schwanken der Heimat-Bilder zwischen Begrenzung und Entgrenzung realisiert.
3.1 „Die Heimat“ im Konjunktiv
Hölderlin setzt in seinen Gedichten „Entdeckerfiguren und Schiffsreisende“[43]ein. Besonders in der auf den Sommer 1800 datierten, im alkäischen Versmaß geschriebenen Ode „Die Heimat“[44] ist eine solche transitorische Figur von Bedeutung. Der Schiffer, der zu Beginn der Ode „heim an den stillen Strom“(v. 1) kehrt, ist als antagonistische Figur zu dem lyrischen Ich konzipiert. Der Schiffer agiert, wenn er „[v]on Inseln fernher“ (v. 2) zurück in die Heimat kehrt, gewohnt gelassen. Mit seinem problemlosen Changieren zwischen Wasser und Land, Land und Wasser ist er dem lyrischen Ich überlegen, das zwar wieder nach Hause kehren möchte, sich für eine Heimkehr aber nicht bestimmt fühlt, da er mit leeren Händen nach Hause kommen würde. Wo der Schiffer während seiner Reise „Güter“ (v. 4) „geerntet“ (v. 2) hat und diese in seine als geografischen Raum konzipierte Heimat bringt, hat das lyrische Ich während seiner Abwesenheit nur „Leid“ (v. 4) erfahren bzw. solches angesammelt. Belastet durch diesen Umstand und den damit einhergehenden Zweifeln formuliert das lyrische Ich die Überlegungen zur Rückkehr bloß im Konjunktiv. Eine Rückkehr findet hier nur imaginativ statt bzw. wird nur imaginativ als Möglichkeit thematisiert. Diese Verlagerung der Heimkehr in den Bereich des Möglichen − aber eben nicht Wirklichen − stellt vor allem Jens in seinem Essay heraus:
Käm und hätte und wenn: Nie ist in der deutschen Literatur Heimat als das große Voraus: als künftige Herberge und als utopischer Besitz, wenn die Zeit sich erfüllt hätte, mit jener Inständigkeit beschworen worden wie in Hölderlins Gedichten […].[45]
In der Sprache des Heimwehs wird ‚Heimat‘ in der Ode ebenso ersehnt wie auch als fragwürdig und brüchig in Aussicht gestellt. Die Fragen des lyrischen Ich unterstreichen dessen Unsicherheit: ist Heimat noch das, was es dem Ich mal war? Einhergehend mit diesen Fragen − ob die „teuren Ufer“ (v. 5) es noch aufnehmen und seine Leiden zu stillen vermögen würden (vgl. v. 5) − wird der Versuch seitens des lyrischen Ich unternommen, der ‚Heimat‘ das Versprechen abzunehmen, als solche für immer für das lyrische Ich bestehen zu bleiben. In der fünften Strophe offenbart sich des lyrischen Ich Verzweiflung vor Heimweh und Liebeskummer am deutlichsten, wenn in einer Wiederholung geäußert wird, dass ihm der Liebeskummer wohl nicht zu heilen sei: „ich weiß, ich weiß / Der Liebe Leid, dies heilet so bald mir nicht […]“ (v. 17f.). Wenn im Nachfolgenden (vgl. fünfte Strophe) die Substantive „Wiegengesang“, „Sterbliche“ und „Busen“ sowie das Partizip Präsens „tröstend“ und das Verb „singend“ verwendet werden, ist eine Kulisse geschaffen, die das lyrische Ich wie ein Kind erscheinen lässt. So wie ein Kind auf seine Eltern angewiesen ist, scheint demnach das lyrische Ich auf seine Heimat angewiesen zu sein.
Trotz dieser offenkundigen Verhandlung des Heimat-Motivs in „Die Heimat“ bleibt festzuhalten, dass ‚Heimat‘ erst in der Mitte der Ode genannt wird (als letztes Wort der dritten von insgesamt sechs Strophen). Diese Mittelstellung verleiht der ‚Heimat‘ den Status eines Zentrums, um das sich elliptisch Assoziationen entfalten. Dieses Zentrum symbolisiert aber auch den Wechsel des lyrischen Ich von Landschaftshuldigungen zu solchen der Familie. Einhergehend mit der Nennung von „der Mutter Haus“ (v. 13), „liebender Geschwister Umarmungen“ (v. 14) und „Banden“ (v. 16) scheinen „sichre Grenzen“ (v. 13) dem Ich wieder sicheren Boden zu geben. Dass jedoch eine solche Konzeption der Heimat als familiär eingegrenzte Einheit von Mutter und Geschwistern dem Ich letztlich nicht das Leiden nehmen kann, zeigt der mit der letzten Strophe der Ode einsetzende Dialog mit den Göttern, der das lyrische Ich zu der Erkenntnis kommen lässt, dass die Götter den Menschen auch „heiliges Leid“ (v. 22) schenken und er „zu lieben gemacht“ (v. 24) auch leiden muss. Die Benennung des Göttlichen zeigt, dass in Hölderlins Lyrik ländliche und kulturmythologische Räume ineinander aufgehen, die Räume eben nicht voneinander abgegrenzt sind. Gerade auch die Formulierung „[e]in Sohn der Erde“ (v. 23) zeigt, dass selbst der familiäre Bereich verlassen werden kann und das lyrische Ich sich als Sohn der Erde einem größeren Ort und somit einer größeren Konzeption von Heimat und Beheimatung zuordnet. Folglich kann vermutet werden, dass eine begrenzte Konzeption von Heimat das lyrische Ich eher einschränkt, da es mit dieser einen Heimat Erwartungen verknüpft, die nicht erfüllt werden können. Erst die Zuwendung zum Überirdischen öffnet auch den Horizont des lyrischen Ich für die Erkenntnis bzw. kulminiert in der Erkenntnis, dass das Liebesleiden dem Charakter inhärent ist.[46]
Wenngleich die Ode ‚Heimat‘ bzw. eine Heimkehr in ebendiese problematisiert und ihr damit auch negative Eigenschaften zuschreibt – insofern als das lyrische Ich sich verpflichtet glaubt, seiner Heimat bei der Heimkehr „Güter“ mitbringen zu müssen −, geht damit kein Bedeutungsverlust der Heimat und des Festhaltens an ihr einher. Vielmehr wird ‚Heimat‘ als Raum der Geborgenheit, an dem man sein Leiden artikulieren und zeigen kann, idealisiert – ob im privat-familiären oder im Raum der Natur mit den Wäldern der Jugend und den kühlen Bächen und ihrer „Wellen Spiel“ (v. 9).
3.2 „Die Wanderung“ zum Kaukasus
Die auf das Frühjahr 1801 datierte Hymne „Die Wanderung“[47] gehört mit „Am Quell der Donau“, „Der Rhein“, „Germanien“, „Patmos“ und „Der Ister“ zu den sogenannten Vaterländischen Gesängen Hölderlins.[48] Die Hymne ist streng triadisch aufgebaut. Mit ihren drei Mal zwölf, zwölf und fünfzehn Zeilen hat sie insgesamt neun Strophen. Wenngleich für die Hymne und ihre drei Strophentriaden eine feste formale Struktur nachweisbar ist, erscheint der Inhalt bei einer ersten Lektüre widersprüchlich. Vornehmlich ist dies auf die Ortswechsel und Wechsel der erzählten Zeit zurückzuführen. Die Hymne wurde recht zeitnah zu ihrer Entstehung 1802 in Fora. Teutschlands Töchtern geweiht. Eine Quartalsschrift von Freunden und Freundinnen des schönen Geschlechts (Zehnter Jahrgang, Viertes Vierteljahr) gedruckt. Hölderlin hatte die Hymne selbst eingereicht.[49] Sein Heimatdenken mündet hier in ein „poetologisch-kultur-politisches Großprojekt“[50]: Wenn er die Grazien Griechenlands am Ende der zweiten Strophe der dritten Strophentriade nach Hesperien zu kommen bittet – sofern „die Reise zu weit nicht ist“ (v. 101) − offenbart sich damit Hölderlins Versuch, „Klarheid [sic!] über sein eigenes Verhältnis zu Griechenland, und wichtiger noch, über das Verhältnis von Deutschland und Griechenland zu erlangen“.[51] „Durch Kulturtransfer und Bewegungen vom Eigenen in das Fremde bzw. vice versa wird hier eine Politik der Übersetzung der Kulturen in Gang zu setzen gesucht“[52], obgleich doch von einer grundlegenden Differenz, einer Alterität zwischen der süd-östlichen Kultur − also der der antiken Griechen – und der nord-westlichen der Hesperier ausgegangen wird. Wenngleich folglich das Verhältnis zwischen Griechenland und Hesperien durchaus antinomisch konzipiert ist, wird doch gerade die Auseinandersetzung mit diametral differenten Eigenschaften zum Ausgangpunkt der Reflektion über ‚Heimat‘. Meiner Meinung nach unternimmt Hölderlin mit diesem Gedicht den Versuch der Gewinnung des Eigenen mittels eines Durchgangs durch das Fremde. Dass man sich erst von der Mutter ‚Heimat’ im Sinne eines konkreten Ortes der Beheimatung lösen muss, um in der Fremde das Eigene zu erkennen, wird in „Die Wanderung“ von der Handlung selbst angeregt. So ist die Kategorie des Fremden für die hier vorgeschlagene Lesart des Gedichts ebenso von Bedeutung wie die Kategorie des Eigenen. Wenngleich meine Lesart nicht beansprucht, Binders Aussage anzufechten, „Die Wanderung“ sei die einzige Hymne auf die schwäbische Heimat Hölderlins,[53] möchte ich mich mit meiner Interpretation vor allem eine Diskussion zweier binärer Kategorien als Konnex anregen.
Die erste Strophentriade öffnet mit der huldvollen Ansprache an die Landschaft von Schwaben, die in ihren Einzelheiten so liebevoll und vor allem gründlich beschrieben wird, dass sich ein konkreter geografischer Raum erschließen lässt, dem laut Binder in etwa das heutige Baden-Württemberg entspricht[54]: „Im Süden die Alpen und der Bodensee, im Westen der Oberrhein. Nord- und Ostgrenze sind aus Städtenamen zu erschließen, die Hölderlin dem Vers „und deine Kinder, die Städte“ […] beigefügt hat.“[55]
Der Blick des lyrischen Ich öffnet sich im Anschluss an die Beschreibungen von Bächen und Bäumen, „tiefgrünenden Laubs voll“ (v. 6), nach oben und dem „Alpengebirg der Schweiz“ (v. 7) zu. Den Blick ins Offene gerichtet formuliert das lyrische Ich, dass es schwer sei, die „angeboren[e…] Treue“ (v. 18) zu dieser Landschaft aufzugeben, dass „[s]chwer [den Ort] verläßt,/ Was nahe dem Ursprung wohnet“ (v. 18f.). Dennoch sei es nach Auffassung des lyrischen Ich von den Bewohnern des Ortes falsch zu glauben, dass es „nirgend besser zu wohnen“ (v. 24) wäre. Das lyrische Ich versteht sich im Kontrast zu den anderen Bewohnen und in seiner Rolle als Dichter vielmehr als eine Schwalbe, die ihrem Freiheitsdrang nachspürt. Wenn es in der ersten Zeile der dritten Strophe heißt: „Ich aber will dem Kaukasos zu!“ (v. 25), wird durch die Verwendung des Konjunktors „aber“ nicht nur die Nähe vom lyrischen Ich und der Ferne sprachlich vorgeführt, sondern eben auch dessen Entgegensetzung zu den anderen Bewohnern des Alpenortes. Der „Kaukasos“ kann als ein Gegenbild zu den heimischen Alpen gelesen werden. Mit der Bewegung des lyrischen Ich hin gen Kaukasus geht eine Bewegung in die Vergangenheit einher – der Wechsel der Zeiten ist im Anschluss an die mit dem Heimat-Motiv verbundene Raumthematik auch als Wechsel von Kulturräumen zu deuten. Doch ist diese Wanderung durch Räume nicht als die einzige zu nennen und es muss ungeklärt bleiben, auf welche der meines Erachtens nach drei Wanderungen sich der Titel der Hymne bezieht, wenn nicht gar auf alle drei. Neben der obigen des lyrischen Ich wird die Wanderung der griechischen Grazien nach Hesperien vom lyrischen Ich erhofft. Und auch von einer vor langer Zeit situierten Völkerwanderung des deutschen Geschlechts und ein Zusammentreffen desselben „[m]it Kindern der Sonn‘ / [a]m schwarzen Meer“ (v. 36) wird berichtet. Die von dem lyrischen Ich erhoffte Wanderung der Griechen nach Hesperien kann als Grund der Wanderung des lyrischen Ich nach Griechenland verstanden werden. Diese wechselseitigen Wanderungen des Hesperischen zum Griechischen und des Griechischen zum Hesperischen sind spiegelbildlich konzipiert: Analog zur griechischen Blüte wird eine Erfüllung der vaterländischen Umgebung anvisiert, die zur Folge hätte, dass das lyrische Ich in seiner geografisch nahe den Alpen liegenden Heimat nicht nur seiner Biografie nach dort seine Heimat hat, sondern eine solche dort durch die griechischen Grazien kulturell zu verankern im Stande wäre. Denn es ist offensichtlich, dass Griechenland ihm Vorbild einer Kultur ist, die er gerne die eigene nennen würde.
Hölderlins Überlegung könnte […] gelautet haben: Wenn das Griechische ins Vaterländische eingeholt werden soll, dann ist zu sprechen: erstens von der Heimat und von Hellas und zweitens von den Griechen damals und von uns heute. Das ergibt eine klare geographische und geschichtliche Gliederung [der Hymne].[56]
Im Anschluss an die Gliederungen geografischer und geschichtlicher Natur sei hier an die drei Ebenen erinnert, auf denen das Heimat-Motiv bei Hölderlin zum Tragen kommt: Das Landschaftliche, das Geschichtliche und das, was man Geist der Heimat nennen könnte. Die ersten beiden Ebenen werden in der Hymne miteinander verwoben; sie können vom lyrischen Ich durchwandert werden − eine Begrenzung von Räumen wird demnach unterlaufen. Diese Raumkonzeption wird von Binder denn auch als gelungen verstanden, der meint, dass die „[inhaltliche] Gliederung die formale Struktur des Gedichts so überspielen [muss], daß Hier und Dort und Jetzt und Einst nicht getrennt bleiben, sondern sich über Raum und Zeit hinweg verbinden lassen […]“[57].
Das Fremde soll förmlich eingeholt werden und fürs Eigene fruchtbar gemacht werden, doch zunächst scheint es zu klären zu geben, wo aber die „liebe[n] Verwandten“ wohnen. Die Antwort in der sechsten Strophe weiß nur zu sagen, wo sie einst gewohnt haben, und entfaltet daraus einen Preis Griechenlands und seiner goldenen Zeit […].[58]
Die Fremde wird vor allem über die Huldigung griechischer Orte in der letzten Strophe der zweiten Strophentriade und in der ersten Strophe der dritten Strophentriade eingeholt. Unabhängig davon, dass dieses hervorstechende Gestaltungsmittel − die exponierte Reihung griechischer Lokalitäten − wohl eng mit dem hymnischen Charakter des Gedichts zu denken sind, klingen sie wie „mythologische Reminiszenzen eines modernen Philhellenen“[59]. Mittels dieser „Reminiszenzen“ wird eine Topografie des griechischen Raumes von Kleinasien bis zum Mutterland geliefert, wobei die Ortsnamen sogar in geschichtlicher Reihenfolge auftauchen.[60] Es werden zudem am Ende der zweiten und am Anfang der dritten Strophentriade auch Symbole der goldenen Zeit Griechenlands aufgeführt. Diese Symbole stellen erneut signifikant die Sehnsucht des lyrischen Ich nach kultureller Heimat heraus. Eine Kultur, in der die Inseln von „Wein bekränzet“ (v. 69) und „im Weinberg“ (v. 81) dem lyrischen Ich „die jungen Pfirsiche grünen“ (v. 82).
Reflexionen über ‚Heimat‘ finden sich in dieser Hymne jeweils in den Mitten der drei Strophentriaden. Wo die erste vom Wohnen nahe dem Ursprung erzählt („Was nahe dem Ursprung wohnet“ (v. 18f)), wird in der zweiten Triade vom einst geschlossenen Bund mit dem Fremden/den Fremden erzählt („Denn aus den heiligvermählten / Wuchs schöner, denn Alles, […] ein Geschlecht auf“ (v. 57f.). In der Mitte der dritten Strophentriade geht es dann um die Erneuerung ebendieses Bundes, wenn das lyrische Ich den eigentlichen Grund seiner Wanderung vorträgt: „Bin ich zu euch, ihr Grazien Griechenlands, / Ihr Himmelstöchter, gegangen, / Daß, wenn die Reise zu weit nicht ist/ Zu uns ihr kommet, ihr Holden!“ (v. 99-102). In nuce ist in diesen drei Sätzen die Gesamthandlung des Gedichts enthalten. ‚Heimat‘ wird in diesem Gedicht folglich vor allem als geistige Heimat verhandelt. Es geht hier zentral um die Frage, wie gelebt werden will, wohingegen im nachfolgenden Gedicht nicht das Leben, sondern der Tod zentrale Bedeutung für das lyrische Ich und dessen Heimatsuche einnimmt.
3.3 „Mnemosyne“ und Tod
Die vermutlich noch im Jahr 1803 entstandene Hymne[61] „Mnemosyne“[62] zählt zu den wichtigsten Hymnen der Spätdichtung Hölderlins. Die lyrische Verhandlung von ‚Heimat‘ ist hier zwar weniger augenfällig als in den zuvor behandelten Gedichten, dennoch lassen sich von dieser Hymne ausgehend interessante Thesen dieser Arbeit unterstreichen und erweitern. Die zweite Fassung der Hymne, die für die folgende Interpretation zugrunde gelegt wird, ist „auf den letzten Seiten des Homburger Folioheftes (Homburg F, dort S. 90/91(92)“[63] überliefert. „Mnemosyne“, die „Erinnerung“, ist in der griechischen Mythologie die Tochter des Uranos und der Gaia; sie ist „die Mutter der Musen (Hesiod, Theogonie, v. 53f.) und insofern Ursprung aller Künste, nicht zuletzt der Dichtung.“[64] Dieser titelgebende Rückgriff auf die griechische Mythologie lässt vermuten, dass hier abermals nicht nur Zeit-, sondern auch Kulturräume von zentraler Bedeutung sind und vielleicht sogar verknüpft werden. Wenngleich die Hymne den für Hölderlin typischen Prozesscharakter aufweist[65], wurde der Text seitens der Forschung vielfach als uninterpretierbar und unzugänglich wahrgenommen.[66]
Problembehaftet ist zum ersten die kompositorische Anlage: Viele der von Hölderlin gewählten Bildlichkeiten sind vieldeutig oder scheinen ohne Bezug zum Kontext zu stehen, ähnliches gilt für die syntaktischen Konstruktionen. […] Sorgen die Schwierigkeiten, die der Text dem verstehenden Zugriff bereitet für eine komplexe offene Aussagestruktur, so erweist sich Mnemosyne auf der anderen Seite als ein erfrischend zugänglicher Text. Denn es handelt sich bei diesem großartigen Gedicht um einen der glücklichen Fälle, in denen die Wucht der Bildlichkeiten und des sprachlichen Rhythmus, die Schroffheit der Satzfügung und die enthusiastische Ergriffenheit des Sprechers eine gewissermaßen ‚unmittelbare‘ zunächst rein emotionale Verstehensweise ermöglicht.[67]
Zeigt bereits der Titel an, dass Hölderlin sich hier mit dem antiken Griechenland auseinandersetzt, bleibt die griechische Muse selbst doch zunächst unerwähnt: In der ersten Strophe wird von „Feuer“, „Frücht[en]“, „Schlangen“, dem „Gesetz“ und bösen „Pfade[n]“ gesprochen (vgl. v. 1-9). „Bild folgt auf Bild“[68]. „Der Mnemosyne Stadt“ wird erst in Verszeile 46 (dritte Strophe) aufgerufen. Das Gedicht umfasst drei Strophen mit jeweils siebzehn Zeilen. Der streng triadischen Grundanordnung steht Hölderins Verzicht auf Reime, auf eine metrische Regelung der Zeilenlängen und auf ein durchgehendes rhythmisches Muster gegenüber. Dennoch stechen die syntaktischen Parallelismen hervor, die besonders in der ersten Strophe zu finden sind. Zudem lässt sich gerade in der Eingangszeile Hölderlins häufige Verwendung von Alliterationen ausmachen: „Feuer“, „Frücht“ und „getaucht“, „gekochet“ und „geprüfet […] Gesetz“. Auch die Hügel des Himmels (vgl. v. 5) können hier angeführt werden. Die schon im Kontext von „Die Wanderung“ betonte Konjunktion „aber“ scheint für „Mnemosyne“ rekurrierend auf die Quantität ihrer Verwendung von Bedeutung zu sein. „Aber bös sind“ (v. 8), „[v]ieles aber ist […]“ (v. 13) veranschaulichen diesen Eindruck. Die Konjunktion taucht in der ersten und dritten Strophe jeweils drei Mal auf. Wo in den ersten zwei Strophen vor allem die Aneinanderreihung von symbolträchtigen Bildern das Lesen begleitet, erscheint gerade die dritte Strophe im Kontrast dazu mit ihren Bezügen auf die griechische Mythologie und Topografie erklärungsbedürftig zu sein. Der Wechsel von scheinbar einfach verständlichen Bildern hin zu einer komplexen, Vorwissen beanspruchenden Strophe erinnert an „Die Wanderung“, wo die Zeit- und Ortswechsel dem Leser doch auch einiges an Mitdenken und Vorwissen abverlangen.
Vorausgesetzt wird zunächst [in der dritten Strophe] die Kenntnis der zentralen Figuren aus Homers Ilias: Achilles und Ajax […]. Darüber hinausgehend stehen zwei der in Mnemosyne verwendeten Ortsangaben in enger Verbindung mit den Geschehnissen des trojanischen Krieges. Die Salamis bezeichnet eine Insel in der Attika Griechenlands. […] Der Feigenbaum und der Skamandros bilden in Mnemosyne die letzten Ruhestätten der großen Heroen.[69]
Im Anschluss hieran wird von Kithäron gesprochen, einem Gebirge, das als Grenze Attika und Böotien trennt und zugleich eine Kultstätte Dyonisos‘ ist.[70] Die sich im Süden dieses Gebirges befindende Stadt Leuthersis schlägt den Bogen zur Gottheit Mnemosyne – soll diese doch an den Hängen des Eleuther gewaltet haben (vgl. Hesiod, Theogonie, v. 53-55). Jochen Schmidt macht in seinem Kommentar auf die doppelte Valenz von Mnemosyne in dem Gedicht aufmerksam. Schmidt zufolge erscheine Mnemosyne „zuerst als eine gegen die Tendenz zum ‚ungebundenen‘ gerichtete, bewahrende und existenzsichernde Kraft“[71], dann aber auch als eine Kraft, „die existenzauflösende Energien entbindet“[72]:
Darin erweist sich psychologisch die Unentrinnbarkeit des Drangs ins Ungebundene, eine Untrinnbarkeit, die sich kosmisch schon in der ersten Strophe als Auflösung der „alten / Gesetze der Erd!“ (v. 11f.) manifestiert.[73]
Neben der Mnemosyne ist es vor allem die Figur des zornigen Wanderers (v. 32), die auf den ersten Blick zwar den Lesefluss unterbricht − denn sie scheint weder zum Vorangegangenen noch zum Folgenden in Bezug zu stehen −, die gerade aber in Bezug zur Heimat-Thematik interessant ist. Spannend ist diese „[f]ern ahnend[e]“ (v. 33) Figur insofern, als dass sie die Bedeutsamkeit der Fremde in dieser Hymne aufzeigt, wenn Hölderlin sie fragen lässt: „aber was ist dies?“ (v. 34). Die Figur des Wanderers wurde in diesem Kapitel bereits anlässlich ihrer Rolle als lyrisches Ich in „Die Wanderung“ und dort als transitorische Figur eingeführt. In „Mnemosyne“ scheint es, fehlt ein lyrisches Ich, bzw. es begegnet dem Leser im emphatischen Sinne nicht. Als Sprecher tritt stattdessen ein Kollektiv auf (vgl. v. 15, 16 und 19). Doch wenn in Verszeile 35f. dann „mein Achilles“ (v. 36) stirbt, ist die Verwirrung seitens des Lesers groß. In Verszeile 49 tritt wiederum „einer“ auf, der wohl durch die vorangegangene Formulierung von „mein Achilles“ als Erzähler assoziiert werden darf.[74] Stefan Schenk-Haupt spricht sich dafür aus, auch den Wandersmann auf dieses Sprecherkonstrukt hin zu assoziieren, weil auch dieser Wandersmann durch das Partikel „ein“ eingeführt wird. Wenn der Zorn des Wandersmannes jedoch den Zorn des Achilles antizipiert, so scheint laut Schenk-Haupts Interpretation dem Wandersmann ein Maß an Selbstbeherrschung abverlangt zu werden, das dem Achilles fehlte.[75] Einer solchen Deutung schließt sich auch Schmidt an, wenn er sagt, dass hier der Dichter seinem lyrischen Ich die Helden Achill und Ajax identifikatorisch zu Seite stellt.[76] Schmidt meint, dass der Dichter sein entgrenzendes Erinnerungsvermögen (Mnemosyne), „das zur zerstörerischen, weil zum Selbstverlust führenden ‚Trauer‘ (v. 51) wird, als dichterischen ‚Zorn‘, als tragischen furor poeticus dem gleichfalls tragischen furor heroicus an die Seite“[77] stellt: „Gerade in der Erinnerung vollzieht sich die Identifikation mit dem entgrenzenden Los der Helden, weil die Erinnerung selbst zum Entgrenzungserlebnis wird.“[78] Neben Achilles (Heldentum) und Ajax (Wahnsinn und Selbstmord) findet auch Patroklos (Freundschaft) Erwähnung. Der gemeinsame Nenner dieser griechisch-mythologischen Figuren ist ihr Tod. So erscheint es schlüssig, dass aus dem Sprecherkollektiv ein Sprecherindividuum geworden ist, das nun als Wandersmann assoziiert werden darf. Der Wanderer wird zu einem einsamen Ich, das überlebend einzig ist. So veranschaulicht die Hymne diametrale Gegensätze, kann diese doch aber vereinen. Die Vereinigung ebendieser Gegensätze ist in Bezug zu Hölderlins Konzept des Harmonischentgegengesetzten zu lesen. Das Harmonisch-entgegengesetzte nämlich zeigt sich in der lyrischen Verquickung von Gegensätzen in der zweiten, also der mittleren Strophe: Es ist dort die Rede von „Sonnenschein“ (v. 18f.) und trockenem „Staub“, von „Schnee, wie Maienblumen“ (v. 25). Anschließend introduziert die dritte Strophe das Bild des Wandersmannes, der „mit / Dem andern“ (v. 33f.) zu gehen beabsichtigt. Will er sterben? Ist das Andere nicht auch hier das Griechische? Die Anderen Achilles, Ajax und Patroklos?
Wenngleich die Forschung vielfach herausgestellt hat, dass das Heimat-Motiv in diesem zweiten Entwurf des Gedichts viel geringer in Erscheinung tritt als in dem ersten, der um die sogenannte „Zeichenstrophe“ erweitert ist, verweist das Sprechen von Wald und Alpen doch auf häufige Heimat-Bilder Hölderlins. Wenn es heißt: „Und heimatlich die Schatten der Wälder und es blühet / An den Dächern der Rauch […]“ (v. 20f.) wird eine Blickrichtung vom Boden, von der bekannten Erde mit ihren Wäldern, Richtung Himmel gelenkt, wo es „blühet / […] bei alter Krone“ (v. 20f.). Diese alte aber dennoch in Blüte stehende Krone kann als Symbol für das Griechische gedeutet werden, auf das sich der Blick des Sprecherkollektivs hier richtet. Meiner Meinung nach wird mit dieser Hymne aber auch gezeigt, dass das Griechische eben vergangen ist, die Heroen gestorben sind, das lyrische Ich verstanden als Wandersmann eben nicht im Umfeld dieser mythischen Figuren leben kann. Wenngleich in diesem Gedicht der hesperische Raum zugunsten eines griechischen verlassen wird, so endet diese Wanderung mit der Einsamkeit des Wandersmannes. ‚Heimat‘ kann also nicht gänzlich offen konzipiert durch alle Räume im Offenen verortet werden, weil einige Kulturräume eben ob ihres Vergangenheitsstatus‘ nur eine imaginäre Heimat bieten. Dass man sich dessen bewusst sein soll, scheint mir der dem Leser gewidmete Ratschlag dieser Hymne zu sein. Es muss demnach ein neues Verhältnis zwischen Gegenwart und Vergangenheit geschlossen oder aber sich gefragt werden, ob man das Griechische oder aber das Hesperische als ‚Heimat‘ benötigt − oder ob man sich nicht gänzlich lösen kann von derlei Kategorien zur Heimatkonstruktion. Hölderlins Heimat-Motiv fragt folglich, wie es mehr als 150 Jahre später auch Jean Améry fragen sollte: „Wie viel Heimat braucht der Mensch?“ Und in welchem Maß muss diese ‚Heimat‘ durch eine Auseinandersetzung mit dem Fremden immer wieder aktualisiert werden?
4 Schlussbetrachtung
Kein Nürtingen ohne Theben, kein Tübingen oder Homburg ohne Athen. Im Ästhetischen konnte für Hölderlin die Heimat ein synthetischer Begriff sein, eine Verbindung aus Griechischem und Hesperischem.[79]
Diese Verbindung ist ein poetisches Ja zu einem Schwebezustand, der als das Harmonischentgegengesetzte so auch von Hölderlin gewollt war; er braucht nicht wählen zwischen wandern und bleiben und dem Fremden und dem Eigenen. Wenngleich seine Verhandlung von ‚Heimat‘ nicht ohne den Rekurs auf feste geografische Koordinaten auskommt und demnach nicht ins Offene konzipiert gedeutet werden kann, kommt Hölderlins Heimatdichtung und der in den hier behandelten Gedichten angesprochene Schwebezustand in diesen Jahren seiner Spätdichtung zur vollen Blüte. Wenn mit dem nur im Konjunktiv geäußerten Willen der Heimkehr in „Die Heimat“ ein durchaus ambivalentes Heimat-Bild gezeichnet wird, zeigt sich in diesem Gedicht und gerade in der Figur des Antagonisten, dem Schiffer, dass es Hölderlin mit einer Reflexion von Heimat auf Metaebene durchaus ernst ist – bei ihm eben nicht nur die landschaftliche Ebene und die geschichtliche von Bedeutung sind, er sich stattdessen intensiv auch mit dem auseinandersetzt, was Binder als „Geist der Heimat“ bezeichnet. Gerade die in den Gedichten aufkommenden Fragen beziehen sich auf die vermeintlich binären Kategorien von Eigenem und Fremdem:
Lieber die Fremde als eine befremdende Heimat? Oder lieber eine beheimatende Utopie des Bleibenkönnens als ein zermürbendes Irren in der Fremde? Hölderlin hat sich diese Fragen wiederholt gestellt und durchaus nicht immer gleich beantwortet.[80]
Dass Hölderlin seine Fragen nicht immer identisch beantwortet hat, muss ihm als hohe Reflexion angerechnet werden. Denn identische Antworten generieren keine neuen Fragen. So kann man für Hölderlin festhalten, dass scheinbar widersprüchliche Konzeptionen von ‚Heimat‘ ihm auch immer wieder Anlass gaben, seinen Entwurf von ‚Heimat‘ zu überdenken. Die in Hölderlins Lyrik abgebildete Sehnsucht, zu wissen, was ‚Heimat‘ (für das von ihr sprechende Individuum) ist, ist im Grunde so alt wie der Mensch; diese Frage entfaltet sich an den entwicklungsbedingten Fragen: Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Hölderlin hat diese Fragen in unterschiedlichen Phasen seines Schreibens immer wieder sich und seinen Gedichten gestellt; und so entfaltet sich bei ihm eine Poesie von Heimat und Fremde, Nähe und Ferne, vom ständigen Kommen und Gehen.
Appendix
Die Heimat
Froh kehrt der Schiffer heim an den stillen Strom,
Von Inseln fernher, wenn er geerntet hat;
So käm‘ auch ich zur Heimat, hätt ich
Güter so viele, wie Leid, geerntet.
Ihr teuern Ufer, die mich erzogen einst,
Stillt ihr der Liebe Leiden, versprecht ihr mir,
Ihr Wälder meiner Jugend, wenn ich
Komme, die Ruhe noch einmal wieder?
Am kühlen Bache, wo ich der Wellen Spiel,
Am Strome, wo ich gleiten die Schiffe sah,
Dort bin ich bald; euch traute Berge,
Die mich behüteten einst, der Heimat
Verehrte sichre Grenzen, der Mutter Haus
Und liebender Geschwister Umarmungen
Begrüß‘ ich bald und ihr umschließt mich,
Daß, wie in Banden, das Herz mir heile,
Ihr treugebliebnen! aber ich weiß, ich weiß,
Der Liebe Leid, dies heilet so bald mir nicht,
Dies singt kein Wiegensang, den tröstend
Sterbliche singen, mir aus dem Busen.
Denn sie, die uns das himmlische Feuer leihn,
Die Götter schenken heiliges Leid uns auch,
Drum bleibe dies. Ein Sohn der Erde
Schein‘ ich; zu lieben gemacht, zu leiden.
Die Wanderung
Glückselig Suevien, meine Mutter,
Auch du, der glänzenderen, der Schwester
Lombarda drüben gleich,
Von hundert Bächen durchflossen!
Und Bäume genug, weißblühend und rötlich,
Und dunklere, wild, tiefgrünenden Laubs voll,
Und Alpengebirg der Schweiz auch überschattet
Benachbartes dich; denn nah dem Herde des Hauses
Wohnst du, und hörst, wie drinnen
Aus silbernen Opferschalen
Der Quell rauscht, ausgeschüttet
Von reinen Händen, wenn berührt
Von warmen Strahlen
Kristallenes Eis und umgestürzt
Vom leichtanregenden Lichte
Der schneeige Gipfel übergießt die Erde
Mit reinestem Wasser. Darum ist
Dir angeboren die Treue. Schwer verläßt,
Was nahe dem Ursprung wohnet, den Ort.
Und deine Kinder, die Städte,
Am weithindämmernden See,
An Neckars Weiden, am Rheine,
Sie alle meinen, es wäre
Sonst nirgend besser zu wohnen.
Ich aber will dem Kaukasos zu!
Denn sagen hört‘ ich
Noch heut in den Lüften:
Frei sei’n, wie Schwalben, die Dichter.
Auch hat mir ohnedies
In jüngeren Tagen Eines vertraut,
Es seien vor alter Zeit
Die Eltern einst, das deutsche Geschlecht,
Still fortgezogen von Wellen der Donau,
Am Sommertage, da diese
Sich Schatten suchten, zusammen
Mit Kindern der Sonn
Am schwarzen Meere gekommen;
Und nicht umsonst sei dies
Das gastfreundliche genennet.
Denn, als sie erst sich angesehen,
Da nahten die Anderen erst; dann satzten auch
Die Unseren sich neugierig unter den Ölbaum.
Doch als sich ihre Gewande berührt,
Und keiner vernehmen konnte
Die eigene Rede des andern, wäre wohl
Entstanden ein Zwist, wenn nicht aus Zweigen
herunter
Gekommen wäre die Kühlung,
Die Lächeln über das Angesicht
Der Streitenden öfters breitet, und eine Weile
Sahn still sie auf, dann reichten sie sich
Die Hände liebend einander. Und bald
Vertauschten sie Waffen und all
Die lieben Güter des Hauses,
Vertauschten das Wort auch und es wünschten
Die freundlichen Väter umsonst nichts
Beim Hochzeitjubel den Kindern.
Denn aus den heiligvermählten
Wuchs schöner, denn Alles,
Was vor und nach
Von Menschen sich nannt, ein Geschlecht auf. Wo,
Wo aber wohnt ihr, liebe Verwandten,
Daß wir das Bündnis wiederbegehn
Und der teuern Ahnen gedenken?
Dort an den Ufern, unter den Bäumen
Ionias, in Ebenen des Kaysters,
Wo Kraniche, des Aethers froh,
Umschlossen sind von fernhindämmernden Bergen,
Dort wart auch ihr, ihr Schönsten! oder pflegtet
Der Inseln, die mit Wein bekränzt,
Voll tönten von Gesang; noch andere wohnten
Am Tayget, am vielgepriesnen Hymettos,
Die blühten zuletzt; doch von
Parnassos Quell bis zu des Tmolos
Goldglänzenden Bächen erklang
Ein ewiges Lied; so rauschten
Damals die Wälder und all
Die Saitenspiele zusamt
Von himmlischer Milde gerühret.
O Land des Homer!
Am purpurnen Kirschbaum oder wenn
Von dir gesandt im Weinberg mir
Die jungen Pfirsiche grünen,
Und die Schwalbe fernher kommt und vieles
erzählend
An meinen Wänden ihr Haus baut, in
Den Tagen des Mais, auch unter den Sternen
Gedenk ich, o Ionia, dein! doch Menschen
Ist Gegenwärtiges lieb. Drum bin ich
Gekommen, euch, ihr Inseln, zu sehn, und euch,
Ihr Mündungen der Ströme, o ihr Hallen der Thetis,
Ihr Wälder, euch, und euch, ihr Wolken des Ida!
Doch nicht zu bleiben gedenk ich.
Unfreundlich ist und schwer zu gewinnen
Die Verschlossene, der ich entkommen, die Mutter.
Von ihren Söhnen einer, der Rhein,
Mit Gewalt wollt er ans Herz ihr stürzen und
schwand
Der Zurückgestoßene, niemand weiß, wohin, in die
Ferne.
Doch so nicht wünscht ich gegangen zu sein,
Von ihr, und nur, euch einzuladen,
Bin ich zu euch, ihr Grazien Griechenlands,
Ihr Himmelstöchter, gegangen,
Daß, wenn die Reise zu weit nicht ist,
Zu uns ihr kommet, ihr Holden!.
Wenn milder atmen die Lüfte,
Und liebende Pfeile der Morgen
Uns Allzugedultigen schickt,
Und leichte Gewölke blühn
Uns über den schüchternen Augen,
Dann werden wir sagen, wie kommt
Ihr, Charitinnen, zu Wilden?
Die Dienerinnen des Himmels
Sind aber wunderbar,
Wie alles Göttlichgeborne.
Zum Traume wirds ihm, will es Einer
Beschleichen und straft den, der
Ihm gleichen will mit Gewalt;
Oft überraschet es einen,
Der eben kaum es gedacht hat.
Mnemosyne
Reif sind, in Feuer getaucht, gekochet
Die Frücht und auf der Erde geprüfet und ein Gesetz ist,
Daß alles hineingeht, Schlangen gleich,
Prophetisch, träumend auf
Den Hügeln des Himmels. Und vieles
Wie auf den Schultern eine
Last von Scheitern ist
Zu behalten. Aber bös sind
Die Pfade. Nämlich unrecht
Wie Rosse, gehn die gefangenen
Element und alten
Gesetze der Erd. Und immer
Ins Ungebundene gehet eine Sehnsucht. Vieles aber ist
Zu behalten. Und not die Treue.
Vorwärts aber und rückwärts wollen wir
Nicht sehn. Uns wiegen lassen, wie
Auf schwankem Kahne der See.
Wie aber Liebes? Sonnenschein
Am Boden sehen wir und trockenen Staub
Und heimatlich die Schatten der Wälder und es blühet
An Dächern der Rauch, bei alter Krone
Der Türme, friedsam; gut sind nämlich,
Hat gegenredend die Seele
Ein Himmlisches verwundet, die Tageszeichen.
Denn Schnee, wie Maienblumen
Das Edelmütige, wo
Es seie, bedeutend, glänzend auf
Der grünen Wiese
Der Alpen, hälftig, da, vom Kreuze redend, das
Gesetzt ist unterwegs einmal
Gestorbenen, auf hoher Straß
Ein Wandersmann geht zornig,
Fern ahnend mit
Dem andern, aber was ist dies?
Am Feigenbaum ist mein
Achilles mir gestorben,
Und Ajax liegt
An den Grotten der See,
An Bächen, benachbart dem Skamandros.
An Schläfen Sausen einst, nach
Der unbewegten Salamis steter
Gewohnheit, in der Fremd, ist groß
Ajax gestorben,
Patroklos aber in des Königes Harnisch. Und es starben
Noch andere viel. Am Kithäron aber lag
Elevtherä, der Mnemosyne Stadt. Der auch, als
Ablegte den Mantel Gott, das Abendliche nachher löste
Die Locken. Himmlische nämlich sind
Unwillig, wenn einer nicht die Seele schonend sich
Zusammengenommen, aber er muß doch; dem
Gleich fehlet die Trauer.
Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Hölderlin, Friedrich: „Die Heimat“. In: Deutscher Klassiker Verlag: Hölderlin. Sämtliche Gedichte, herausgegeben von Jochen Schmidt. Frankfurt a. M. 2005, S. 245.
Ders.: „Die Wanderung“. In: Deutscher Klassiker Verlag: Hölderlin. Sämtliche Gedichte, herausgegeben von Jochen Schmidt. Frankfurt a. M. 2005, S. 324-327.
Ders.: „Mnemosyne“. In: Deutscher Klassiker Verlag: Hölderlin. Sämtliche Gedichte, herausgegeben von Jochen Schmidt. Frankfurt a. M. 2005, S. 364-365.
Sekundärliteratur
Bastian, Andrea: Der Heimat-Begriff. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung in verschiedenen Funktionsbereichen der deutschen Sprache. Tübingen 1995.
Berbig, Roland: „Ein Fest in den Hütten der gastlichen Freundschaft: Überlegungen zum Verhältnis von Freundschaft und Heimat bei Hölderlin“. In: Monatshefte für deutschen Unterricht, deutsche Sprache und Literatur (1996: 88, 2), S. 157-175.
Berg-Pan, Renata: „Friedrich Hölderlins Gedicht ‚Die Wanderung‘“. In: Neophilologus (1975), S. 563-578.
Binder, Wolfgang: „Sinn und Gestalt in Hölderlins Dichtung“. In: Hölderlin-Jahrbuch (1954), S. 46-78.
Ders.: „Hölderlins Hymne ‚Die Wanderung‘“. In: Hölderlin-Jahrbuch (1978/79), S. 170-205.
Braungart, Wolfgang: „Heimat – Sprache – poetische Einbildungskraft (Hölderlin, Brecht)“. Vortrag für die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. in Berlin am 30. November 2012, S. 5 (unter:http://www.kas.de/upload/themen/deutschesprache/121130_Vortrag_Braungart.pdf; abgerufen am: 07.08.2014).
Gebhard, Gunther; Geisler, Oliver; Schröter, Steffen: „Heimatdenken: Konjunkturen und Konturen. Statt einer Einleitung“. In: Dies. (Hg.): Heimat: Konturen und Konjunkturen eines umstrittenen Konzepts. Bielefeld 2007, S. 9-56.
Görner, Rüdiger: „Zum Geleit“. In: Ders. (Hg.): Heimat im Wort. Die Problematik eines Begriffs im 19. Und 20. Jahrhundert. München1992, S. 9-10.
Ders.: „Einführendes. Oder: Verständigung über Heimat“. In: Ders. (Hg.): Heimat im Wort. Die Problematik eines Begriffs im 19. Und 20. Jahrhundert. München1992, S. 11-14.
Ders.: „Heimat im Widerspruch“. In: Ders. (Hg.): Heimat im Wort. Die Problematik eines Begriffs im 19. und 20. Jahrhundert. München 1992, S. 50-62.
Ders.: Hölderlins Mitte. Zur Ästhetik eines Ideals. München 1993.
Greverus, Ina-Maria: Der territoriale Mensch. Ein literaturanthropologischer Versuch zum Heimatphänomen. Frankfurt a. M. 1972.
Härtling, Peter: „Heimkunft“. In: Hölderlin-Jahrbuch (1986-1987), S. 1-11.
Jens, Walter: „Nachdenken über Heimat. Fremde und Zuhause im Spiegel deutscher Poesie“. In: Ders. (Hg.): Feldzüge eines Republikaners. München 1988, S. 190-203.
Joisten, Karen: Philosophie der Heimat – Heimat der Philosophie. Berlin 2003.
Schenk-Haupt, Stefan: „Wege der Annäherung an Friedrich Hölderlins Mnemosyne“. In: Literatur in Wissenschaft und Unterricht (2009, 3), S. 149-170.
Schlink, Bernhard: Heimat als Utopie. Frankfurt a. M. 2000.
Schmidt, Jochen: Hölderlins Elegie Brod und Wein. Die Entwicklung des hymnischen Stils in der elegischen Dichtung. Berlin 1968.
Ders.: Kommentar zu „Die Wanderung“. In: Hölderlin, Friedrich: „Die Heimat“. In: Deutscher Klassiker Verlag: Hölderlin. Sämtliche Gedichte, herausgegeben von Jochen Schmidt. Frankfurt a. M. 2005.
Ders.: Kommentar zu „Mnemosyne“. In: Hölderlin, Friedrich: „Die Heimat“. In: Deutscher Klassiker Verlag: Hölderlin. Sämtliche Gedichte, herausgegeben von Jochen Schmidt. Frankfurt a. M. 2005.
[1] Jens, Walter: „Nachdenken über Heimat. Fremde und Zuhause im Spiegel deutscher Poesie“. In: Ders. (Hg.): Feldzüge eines Republikaners. München 1988, S. 190-203; hier: S. 195.
[2] Braungart, Wolfgang: „Heimat – Sprache – poetische Einbildungskraft (Hölderlin, Brecht)“. Vortrag für die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. in Berlin am 30. November 2012, S. 5 (unter: http://www.kas.de/upload/themen/deutschesprache/121130_Vortrag_Braungart.pdf; abgerufen am: 07.08.2014).
[3] Jens: Nachdenken über Heimat, S. 203.
[4] Jens: Nachdenken über Heimat, S. 203.
[5] Zitiert in Jens: Nachdenken über Heimat, S. 203.
[6] Braungart: Heimat– Sprache – poetische Einbildungskraft, S. 13.
[7] Vgl. Braungart: Heimat – Sprache – poetische Einbildungskraft, S. 7f.
[8] Braungart: Heimat – Sprache – poetische Einbildungskraft, S. 7f.
[9] Braungart: Heimat – Sprache – poetische Einbildungskraft, S. 5.
[10] Braungart: Heimat – Sprache – poetische Einbildungskraft, S. 5.
[11] Berbig, Roland: „Ein Fest in den Hütten der gastlichen Freundschaft: Überlegungen zum Verhältnis von Freundschaft und Heimat bei Hölderlin“. In: Monatshefte für deutschen Unterricht, deutsche Sprache und Literatur (1996: 88, 2), S. 157-175; hier: S. 169f.
[12] Schlink, Bernhard: Heimat als Utopie. Frankfurt a. M. 2000, S. 23.
[13]Greverus, Ina-Maria: Der territoriale Mensch. Ein literaturanthropologischer Versuch zum Heimatphänomen. Frankfurt a. M. 1972, S. I.
[14] Schmidt, Jochen: Hölderlins Elegie Brod und Wein. Die Entwicklung des hymnischen Stils in der elegischen Dichtung. Berlin 1968, S. 20.
[15] Görner, Rüdiger: „Heimat im Widerspruch“. In: Ders. (Hg.): Heimat im Wort. Die Problematik eines Begriffs im 19. Und 20. Jahrhundert. München 1992, S. 50-62; hier: S. 52.
[16] Görner: Heimat im Widerspruch, S. 52f.
[17] Binder, Wolfgang: „Sinn und Gestalt in Hölderlins Dichtung“. In: Hölderlin-Jahrbuch (1954), S. 46-78; hier: S. 47.
[18] Görner, Rüdiger: Hölderlins Mitte. Zur Ästhetik eines Ideals. München 1993, S. 100.
[19] Gebhard, Gunther; Geisler, Oliver; Schröter, Steffen: „Heimatdenken: Konjunkturen und Konturen. Statt einer Einleitung“. In: Dies. (Hg.): Heimat: Konturen und Konjunkturen eines umstrittenen Konzepts. Bielefeld 2007, S. 9-56; hier: S. 9
[20] Gebhard, Geisler, Schröter, Steffen: Heimatdenken: Konjunkturen und Konturen. Statt einer Einleitung, S. 9.
[21] Görner, Rüdiger: „Zum Geleit“. In: Ders. (Hg.): Heimat im Wort. Die Problematik eines Begriffs im 19. Und 20. Jahrhundert. München1992, S. 9-10; hier: S. 9.
[22] Vgl. Gebhard, Geisler, Schröter, Steffen: Heimatdenken: Konjunkturen und Konturen. Statt einer Einleitung, S. 10.
[23] Görner, Rüdiger: „Einführendes. Oder: Verständigung über Heimat“. In: Ders. (Hg.): Heimat im Wort. Die Problematik eines Begriffs im 19. Und 20. Jahrhundert. München1992, S. 11-14; hier: S. 14.
[24] Görner: Einführendes, S. 11.
[25] Vgl. Görner: Einführendes, S. 14.
[26] Vgl. Braungart, Wolfgang: Heimat – Sprache- poetische Einbildungskraft (Hölderlin, Brecht), S. 3
[27] Vgl. Görner, Rüdiger: „Einführendes. Oder: Verständigung über Heimat“. In: Ders. (Hg.): Heimat im Wort. Die Problematik eines Begriffs im 19. Und 20. Jahrhundert. München1992, S. 11-14; hier: S. 14.
[28] Zitiert in Görner: Hölderlins Mitte, S. 99.
[29] Gebhard, Gunther; Geisler, Oliver; Schröter, Steffen: Heimatdenken: Konjunkturen und Konturen. Statt einer Einleitung, S. 14.
[30] Gebhard, Gunther; Geisler, Oliver; Schröter, Steffen: Heimatdenken: Konjunkturen und Konturen. Statt einer Einleitung, S. 15.
[31] Gebhard, Gunther; Geisler, Oliver; Schröter, Steffen: Heimatdenken: Konjunkturen und Konturen. Statt einer Einleitung, S. 15.
[32] Schlink: Utopie als Heimat, S.32.
[33] Schlink: Utopie als Heimat, S. 34.
[34] Görner: Zum Geleit, S. 9.
[35] Bastian, Andrea: Der Heimat-Begriff. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung in verschiedenen Funktionsbereichen der deutschen Sprache. Tübingen 1995, S. 176.
[36] Joisten, Karen: Philosophie der Heimat – Heimat der Philosophie. Berlin 2003, S. 11 und 18f.
[37] Binder: Sinn und Gestalt, S. 48
[38] Binder: Sinn und Gestalt: S. 48f.
[39] Binder: Sinn und Gestalt, S. 60.
[40] Binder: Sinn und Gestalt, S. 48.
[41] Binder: Sinn und Gestalt, S. 64.
[42] Binder: Sinn und Gestalt, S. 65.
[43] Gebhard, Gunther; Geisler, Oliver; Schröter, Steffen: Heimatdenken: Konjunkturen und Konturen. Statt einer Einleitung, S. 16.
[44] Hölderlin, Friedrich: „Die Heimat“. In: Deutscher Klassiker Verlag: Hölderlin. Sämtliche Gedichte, herausgegeben von Jochen Schmidt. Frankfurt a. M. 2005, S. 245.
[45] Jens: Nachdenken über Heimat, S. 195. Jens thematisiert bei seiner Verhandlung der Konjunktive in Hölderlins Gedichten neben „Die Heimat“ auch „Rückkehr in die Heimat“, „Heimkunft“, „Die Wanderung“ und „Ihr sicher gebauten Alpen“.
[46] Peter Härtling verweist darauf, dass in dem Wort „schein‘“ gemäß des für Hölderlin bedeutsamen Schwäbischen mehr Misstrauen steckt als im Hochdeutschen. So könnte das Ende des Gedichts auch als dritte im Gedicht gestellte Frage verhandelt werden, die nämlich abermals danach fragt, ob die Heimat der Liebe Leid wirklich nicht zu stillen vermag. Vgl. Härtling, Peter: „Heimkunft“. In: Hölderlin-Jahrbuch. (1986-1987), S. 1-11; hier: S. 6.
[47] Hölderlin, Friedrich: „Die Wanderung“. In: Deutscher Klassiker Verlag: Hölderlin. Sämtliche Gedichte, herausgegeben von Jochen Schmidt. Frankfurt a. M. 2005, S. 324-327.
[48] Vgl. Berg-Pan, Renata: „Friedrich Hölderlins Gedicht ‚Die Wanderung‘“. In: Neophilologus (1975), S. 563-578; hier: S. 563.
[49] Schmidt, Jochen: Kommentar zu „Die Wanderung“. In: Hölderlin, Friedrich: „Die Heimat“. In: Deutscher Klassiker Verlag: Hölderlin. Sämtliche Gedichte, herausgegeben von Jochen Schmidt. Frankfurt a. M. 2005, S. 849.
[50] Gebhard, Gunther; Geisler, Oliver; Schröter, Steffen: Heimatdenken: Konjunkturen und Konturen. Statt einer Einleitung, S. 16.
[51] Berg-Pan: Die Wanderung: S. 563.
[52] Gebhard, Gunther; Geisler, Oliver; Schröter, Steffen: Heimatdenken: Konjunkturen und Konturen. Statt einer Einleitung, S. 17.
[53] Binder, Wolfgang: „Hölderlins Hymne ‚Die Wanderung‘“. In: Hölderlin-Jahrbuch (1978/79), S. 170-205; hier: S. 170.
[54] Vgl. Binder: Die Wanderung, S. 178.
[55] Binder: Die Wanderung, S. 178.
[56] Binder : Die Wanderung: S. 173.
[57] Binder : Die Wanderung: S. 173.
[58] Binder : Die Wanderung: S. 172.
[59] Binder : Die Wanderung: S. 174.
[60] Binder : Die Wanderung: S. 190.
[61] Schmidt, Jochen: Kommentar zu „Mnemosyne“. In: Hölderlin, Friedrich: „Die Heimat“. In: Deutscher Klassiker Verlag: Hölderlin. Sämtliche Gedichte, herausgegeben von Jochen Schmidt. Frankfurt a. M. 2005, S. 1032.
[62] Hölderlin, Friedrich: „Mnemosyne“. In: Deutscher Klassiker Verlag: Hölderlin. Sämtliche Gedichte, herausgegeben von Jochen Schmidt. Frankfurt a. M. 2005, S. 364-365.
[63] Schmidt: Kommentar zu „Mnemosyne“, S. 1031.
[64] Schmidt: Kommentar zu „Mnemosyne“, S. 1035.
[65] Vgl. Schmidt: Kommentar zu „Mnemosyne“, S. 1035.
[66] Schenk-Haupt, Stefan: „Wege der Annäherung an Friedrich Hölderlins Mnemosyne“. In: Literatur in Wissenschaft und Unterricht (2009, 3), S. 149-170; hier: S: 149.
[67] Schenk-Haupt: Wege der Annäherung, S. 149.
[68] Schenk-Haupt: Wege der Annäherung, S. 151.
[69] Schenk-Haupt: Wege der Annäherung, S. 152f.
[70] Vgl. Schenk-Haupt: Wege der Annäherung, S. 153.
[71] Schmidt: Kommentar zu „Mnemosyne“, S. 1035.
[72] Schmidt: Kommentar zu „Mnemosyne“, S. 1035.
[73] Schmidt: Kommentar zu „Mnemosyne“, S. 1035.
[74] Vgl. Schenk-Haupt: Wege der Annäherung, S. 154.
[75] Vgl. Schenk-Haupt: Wege der Annäherung, S. 154.
[76] Vgl. Schmidt: Kommentar zu „Mnemosyne“, S. 1039.
[77] Schmidt: Kommentar zu „Mnemosyne“, S. 1039.
[78] Schmidt: Kommentar zu „Mnemosyne“, S. 1039.
[79] Görner : Hölderlins Mitte, S.100.
[80] Görner : Heimat im Widerspruch, S. 61.